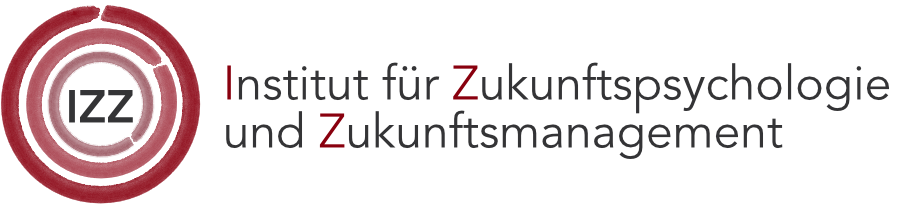Themen
Vorstellung des IZZ
Der Direktor des Institutes für Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement erläutert die ersten Schritte der wissenschaftlichen Arbeit.
Institut für Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement
Die Idee und Notwendigkeit, die Zukunftspsychologie als neue interdisziplinäre Forschungsrichtung aufzubauen und zu etablieren, ergab sich aus den Ergebnissen der „Drei Generationen-Studie“. Unabhängig von der Generationszugehörigkeit dominierte bei allen relevanten Antworten der Befragten eine subjektive, intuitive und emotionale Resonanz und Bewertung. Die bestimmenden Faktoren der Wissensgesellschaft wie Rationalität, Berechenbarkeit und Zahlenlogik spielen in der Lebenswelt der Interviewten eine sekundäre Rolle. Aber auch die emotionalen Perspektiven führen nur selten tatsächlich zu Handlungs- und Veränderungsaktivitäten. Das Vakuum zwischen Einsicht und Umsetzung ist gewaltig.
Vor dem Hintergrund des unausweichlichen Wandels, der durch die demografische und digitale Zäsur hervorgerufen wird, offenbart sich eine gewaltige Schwäche der Prävention, der Antizipation und der Zukunftsgestaltung. In Ermangelung dieser vorausschauenden Handlungskompetenz zeigte sich in der Studie unentwegt eine nachvollziehbare Ignoranz und Verdrängung als Zeichen extremer Wahrnehmungsüberforderung. Der Mensch ist zwar gewillt für sich, seine Familie und seine weiteren Umgebungen Vorsorge zu treiben, aber er weiß immer weniger wie es gemacht werden soll. Gerade bei den Jugendlichen, die die längste Zukunft der Menschheitsgeschichte vor sich haben, ist eine paradoxe Kurzsichtigkeit und Konsumkonzentration vorherrschend.
Gestaltungsebenen der Zukunft
Die demografischen Veränderungen und der wissenschaftlich-technische Fortschritt unserer Gesellschaft geben Anlass dazu, gegenwärtige Zukunftsvorstellungen zu überdenken. Orientierung in den Bereichen Beschäftigung und Altersvorsorge fehlen ebenso wie wegweisende Konzepte im Umgang mit sich verändernden familiären Strukturen und der sinngebenden Gestaltung von durchschnittlich 30 Jahren mehr Lebenszeit. Sind uns individuelle, familiäre und gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit wichtig, gilt es Zukunft auf diesen drei Ebenen neu auszurichten.
Begrifflich entstammt Zukunft dem althochdeutschen Wort zuochumft und bezeichnet ursprünglich das auf jemanden Zukommende. Darüber hinaus wurde im Mittelhochdeutschen ein bevorstehendes Herabkommen Gottes damit verbunden, was im Wort Advent (lateinisch Adventus Domini für Ankunft des Herrn) zum Ausdruck kommt. Der emeritierte Professor für Dogmatik Gisbert Greshake schreibt dem Begriff Zukunft in diesem Kontext eine inhaltliche Zweideutigkeit zu – Zukunft als Kommen (adventus) und Zukunft als Werden (futurum). Demnach steht die erstgenannte Bedeutung für Zukunft die nicht vorhersehbar, planbar und machbar ist, zum Beispiel welchen Menschen wir begegnen, ob wir uns verlieben oder wie lange wir leben. Zukunft als Werden hingegen steht für die Entfaltung der Möglichkeiten, welche in einer Person oder Sache von Beginn an angelegt sind. „So wie die Blüte aus dem Samenkorn hervorgeht, so entfaltet sich die Zukunft des Werdens in einem Entwicklungsprozess aus der Vergangenheit heraus.“ Nach Greshake überschneiden sich die beiden Weisen der Zukunft zwar laufend, sind jedoch ihrem Wesen nach grundsätzlich verschieden.